Veranstaltungsarchiv



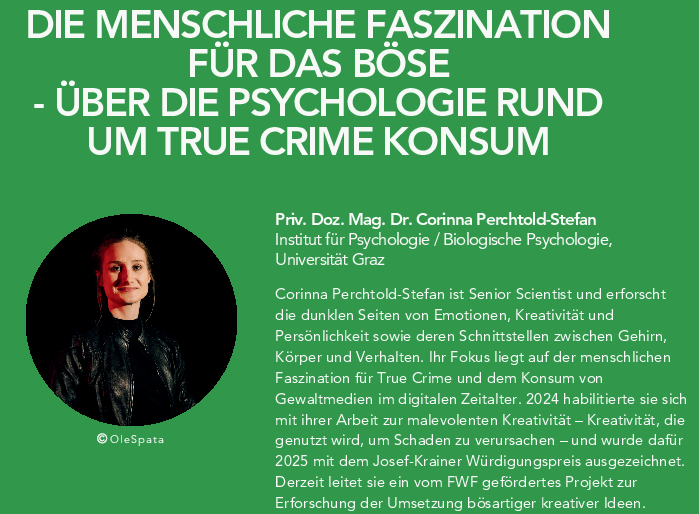


Ältere Vorträge (ab 2019)
Clemens Stachl (Universität St. Gallen) spricht darüber, wie mit Smartphones und anderen Technologien menschliches Verhalten gemessen und Eigenschaften bzw. Merkmale von Individuen digital repräsentiert werden können. Er diskutiert Befunde zur automatischen Messung von Verhalten im Alltag (Mobile Sensing) und zur computationalen Verarbeitung dieser Daten (Maschinelles Lernen).
Obwohl sich die Lebenswelten von Frauen und Männern in den vergangenen Jahrzehnten stetig angeglichen haben, sind Frauen in Führungspositionen in Politik, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft in geringerem Ausmaß repräsentiert als Männer. In den vergangenen Jahren wurden in der psychologischen Forschung unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt, um mögliche Ursachen für diese großen Geschlechtsunterschiede zu identifizieren.
Spätestens seit dem Skandal von Cambridge Analytica in 2018 ist klar, dass die Kombination aus Psychologie und Data Science die Tür zu einer neuen, facettenreichen Welt öffnet: Millionen von Daten aus verschiedenen Quellen sind plötzlich zugänglich und stehen zur Analyse zur Verfügung (Data Science) – Werden diese Daten mit Ergebnissen aus psychologischen Untersuchungen oder Studien verknüpft, kann eine Persönlichkeits-Segmentierung vorgenommen werden, welche zur konkreten Vorhersage von Verhalten herangezogen werden können.
Die heutige Welt ist von einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungsprozess geprägt, der durch eine Reihe von Merkmalen charakterisiert ist. Dazu zählt der vermehrte Einsatz digitaler Technologien in der Arbeitswelt, der durch die COVID19-Pandemie noch beschleunigt wurde. Der Begriff „Arbeit 4.0“ steht im Kern für eine zunehmend digitalisierte, flexible und entgrenzte Form des Arbeitens mit Folgen für die Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse in vielen Bereichen. Viele dieser Veränderungen wirken sich unmittelbar auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten aus.
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, Mitarbeitende, Führungskräfte und Unternehmen auf diese Herausforderungen vorzubereiten und zu begleiten, Krankheiten vorzubeugen bzw. die Gesundheit und das Wohlbefinden zu steigern. Der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) versucht seit 2018, mit einem Förderschwerpunkt österreichische Betriebe im Rahmen von BGF-Projekten bei der Entwicklung innovativer Zugänge in der Auseinandersetzung mit neuen Herausforderungen zu unterstützen und in der Folge zur Nachhaltigkeit des Themas „BGF in der Arbeitswelt 4.0“ beigetragen.
Die Förderung schafft die notwendigen Rahmenbedingungen und österreichische Betriebe sind zur Einreichung von BGF-Projekten eingeladen. Wegen der projektübergreifenden Evaluation können die bisher durchgeführten BGF-Projekte nicht nur anhand ausgewählter Merkmale charakterisiert, sondern auch nach den wahrgenommenen Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung, ihren gesetzten Gesundheitsförderungsaktivitäten und -methoden beschrieben werden.
Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse liegen zahlreiche Rückmeldungen und Beispiele guter Praxis vor. Aufgrund der Vielfältigkeit der umgesetzten Maßnahmen ist es zudem möglich, mehrere Handlungsfelder für eine BGF 4.0 zu identifiziert. Neben dem direkten Nutzen in den erreichten Betrieben bzw. Zielgruppen kann aus den Projekten Wissen, Know-how und Evidenz generiert und zur Unterstützung weiterer Betriebe zur Verfügung gestellt werden. Dafür wurde ein Praxisbuch "Betriebliche Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt 4.0" veröffentlicht und es werden laufend Fortbildungen entwickelt bzw. angeboten. Insgesamt leistet die Initiative einen zeitgemäßen Beitrag zur Qualitätsentwicklung in der BGF und ist als Unterstützung übergeordneter Gesundheitsförderungsstrategien zu sehen.
Neuere Daten des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) des Robert-Koch-Institutes zeigen, dass die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen eingeschränkt ist. So weisen ein Teil der Kinder und Jugendlichen zunehmend psychische Auffälligkeiten auf ...
Professorin an der FH OÖ, Forschungsschwerpunkte Instructional Design, Medienkompetenz, Informelles Lernen, Lernen mit neuen Medien, Selbstreguliertes Lernen, Computerunterstütztes kollaboratives Lernen, Informelles Lernen, Kompetenzerwerb mit neuen Medien.
Dem Lernen mit digitalen Medien werden verschiedene Potenziale zugesprochen, wie Zeit- und Ortsunabhängigkeit oder die rasche und unkomplizierte Wissensvermittlung an unterschiedliche Gruppen von Lernenden. Ein großer Vorteil ist vor allem die Unterstützung des individualisierten und selbstregulierten Lernens. Dies ist jedoch kein Selbstläufer, sondern bedarf insbesondere bestimmter instruktionaler Merkmale in digitalen Lernumgebungen und bestimmter Voraussetzungen seitens der Lernenden und Lehrenden.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der FH OÖ wurde der Frage nachgegangen wie einerseits individuelle Merkmale wie Selbstregulation, Lernorientierung und Motivation und andererseits Merkmale des Instruktionsdesigns für unterschiedliche Lernwege in einer digitalen Lernumgebung verantwortlich sind. In vier Handelsschulen kam eine digitale Lernwelt (chabaDoo) zum Einsatz, welche mittels einer schriftlichen Befragung (81 Schülerinnen und Schüler) nach unterschiedlichen Kriterien bewertet wurde. Im Rahmen des Vortrags werden die Ergebnisse präsentiert und es wird aufgezeigt, welche Faktoren für einen lernorientierten Einsatz von digitalen Medien bedeutsam sind.
Difficulties in mathematical development are a serious handicap for children´s academic career. Cognitive as well as emotional factors have been discussed as underlying factors. I will review various large-sample projects that examined potentially foundational variables supporting cognitive mathematical development and underlying developmental dyscalculia (DD) as well as a project that examined an emotional block of mathematical performance (mathematics anxiety; MA). First, we have screened a large population (n=1004) for DD and we have contrasted several theories of DD. We found that DD was related to weak visuo-spatial memory and weak inhibition skills. We could not support the number sense theory of mathematical development or dyscalculia. We have replicated and extended these findings in a follow-up cross sectional study of Grade 2, 4 and 6 children (n≈1250) that also considered general intelligence. We found that visual and verbal working memory were good correlates of standardized maths performance while number sense related variables were again negligible predictors of maths. Another study (n≈1700) found that MA and DD showed strong dissociation. These findings suggest that cognitive and emotional blocks of mathematical development need different interventions.
Kreativität als die Erzeugung von neuen und nützlichen Ideen, und Eigeninitiative, ein proaktives Herangehen an die eigene Arbeit, werden in der modernen Arbeitswelt immer wichtiger. Aber unter welchen Bedingungen werden Menschen kreativ? Wann zeigen sie Eigeninitiative bei der Arbeit und warum? Der Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Arbeitsgestaltung auf Kreativität und Eigeninitiative auswirkt. Es werden grundlegende Theorien zur Arbeitsgestaltung sowie die Arbeitsmerkmale Autonomie und Arbeitskomplexität und mögliche vermittelnde Prozesse erläutert, und die dazu gehörenden Forschungsergebnisse vorgestellt. Schließlich wird diskutiert, für wen und wann sich Kreativität und Eigeninitiative wirklich auszahlen, und wie sie in der eigenen Arbeitswelt gefördert werden können.
Christopher M. King, JD, PhD, Assistant Professor of Psychology, Doctoral Faculty Member, Associate Director of Clinical Training, Director of Forensic Psychology Concentration, Montclair State University, Montclair, New Jersey, USA; Supervised Permit Holder, Clinical and Forensic Psychological Consulting Services and Morristown DBT, Morristown, New Jersey, USA; Licensed Attorney, Pennsylvania, USA
The intersection of technology and psychology is a growing area of research and practice. However, subfields of psychology vary in the extent to which technological solutions are being studied and applied. This talk will focus, as a sort of case study, on a subfield that has generally lagged behind--psychology and law, and in particular, applied correctional and forensic psychology. Upon release, incarcerated populations reoffend at high rates. Fortunately, extensive research has shown that correctional rehabilitation services decreases rates of criminal recidivism. However, research has also shown that, in addition to access to care issues, many offenders are young, mandated to treatment, and drop out at relatively high rates--and those that drop out have worse outcomes than those who never began treatment in the first place. Accordingly, interesting and maintaining corrections clients in treatments that are made widely available are pressing objectives for correctional rehabilitation. As one potential solution, this talk will discuss the theoretical and practical rationale, qualitative and quantitative research, and collaborative development process that has yielded a serious video game, which incorporates both game play and self-study elements, designed to improve decision-making and knowledge of psychological skills among incarcerated offenders approaching release to the community. Future directions for this research line will be noted, and the actual game will be demonstrated. The talk will be informative for those interested in utilizing available technologies, or developing new ones, for both experimental and applied psychological research.
In der (psychologischen) Forschung stehen wir vor wesentlichen Herausforderungen in Bezug auf die Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit wissenschaftlicher Befunde.
Unter Reproduzierbarkeit wird allgemein verstanden, dass Ergebnisse mit den gleichen Daten erneut berechnet werden können. Unter Replizierbarkeit wiederum versteht man die wiederholte Durchführung einer Studie mit erneuter Datenerhebung.
Sowohl Reproduzierbarkeit als auch Replizierbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen stellen die Grundlage für einen evidenzbasierten Diskurs dar. In den vergangenen Jahren stellte sich jedoch, insbesondere in der Psychologie, heraus, dass eine erschreckend hohe Zahl von Ergebnissen nicht reproduziert oder repliziert werden konnten. Insbesondere wenn ein Effekt nach erneuter Datenerhebung nicht gefunden kann, stellt sich die Frage, ob die Originalergebnissen angezweifelt werden sollen, o-der ob die Replikationsstudie die Originalstudie nicht akkurat nachgestellt hat (Alpha oder Beta Fehler).
In dem Vortrag werden Probleme der Replikation und Reproduktion in der (psychologischen) Forschung herausgestellt, mögliche Ursachen angesprochen und potentielle Lösungen vorgestellt.
Niemand hat etwas dagegen, kompetent zu sein, aber es finden sich immer wieder laute Stimmen, die kritisch gegen eine Kompetenzorientierung an Schulen und Hochschulen argumentieren. Der Begriff der Kompetenzorientierung, der seit einiger Zeit Eingang in pädagogische Institutionen gefunden hat, wird dabei oft verbunden mit Folgen der „Bologna“-Studienreform oder der Einführung von Bildungsstandards, die als problematisch empfunden werden. Es besteht anscheinend Sorge, dass mit der neuen Ausrichtung an Kompetenzen das Wissen keine Rolle mehr spielen und wesentliche Aspekte von Bildung verloren gehen würden. Diese Bedenken und die aktuellen Diskussionen zu diesem Thema sind der Ausgangspunkt des Vortrags. Hier wird zunächst gefragt, ob mit der Kompetenzorientierung denn tatsächlich Wissen irrelevant wird und wichtige Bildungsziele vernachlässigt werden.
Dazu sollen Kompetenzmodelle etwas näher betrachtet und auf Vorstellungen von Bildung bezogen werden. Aber es sollen auch empirische Befunde angesprochen werden, nämlich Befunde über beträchtliche Schwächen unseres Bildungssystems. Sie gaben – und geben weiterhin – Anlass, Unterricht an Schulen wie Hochschulen so anzulegen und weiterzuentwickeln, dass angestrebte
wichtige Ziele wirklich erreicht werden.
Das ist das eigentliche Anliegen einer Kompetenzorientierung, die keineswegs im Widerspruch zu anspruchsvollen Bildungszielen steht. Das Neue daran ist: Die Kompetenzorientierung geht realistisch vom tatsächlichen Können aus und vergewissert sich, ob Fortschritte in Richtung dieser Ziele erreicht wurden.
Menschen sind sehr gut darin, sich im Alltag zurechtzufinden. Wir haben Informationen über wiederkehrende Ereignisse (in unserer Umgebung) gespeichert und können sie abrufen, wenn wir in eine neue Situation geraten. Unsere Erfahrung ermöglicht es uns, uns auf die für die jeweilige Situation relevanten Aspekte der Umgebung zu konzentrieren und schnell angemessen zu reagieren. Dies ist die Basis für alltägliche Fähigkeiten und spezialisierte Expertise, die sich durch Übung entwickeln. Aber all dies hat auch einen Nachteil: Wenn es eine bessere Lösung gibt als die, die wir bereits haben, werden wir Schwierigkeiten haben, sie zu finden.
Ich stelle hier ein Forschungsprogramm vor, das die internen Abläufe dieses kognitiven Paradoxons aufzeigt. Ebenderselbe Mechanismus, der normalerweise hilfreich ist, kann in bestimmten Situationen gefährlich werden. Ich lege zunächst experimentelle Nachweise über die Nachteile dieses Mechanismus vor. Wenn ein Problem vertraute Merkmale aufweist, lösen diese Ideen auf der Grundlage unserer bisherigen Erfahrungen im Umgang mit ähnlichen Situationen aus. Diese Ideen lenken dann die Aufmerksamkeit auf diejenigen Aspekte der Aufgabe, die einen weiteren Beweis dafür liefern, dass der ursprüngliche Ansatz richtig war. Dies führt zu einer schnellen und effizienten Bearbeitung der Aufgabe, wenn die erste Idee eine gute Lösung war. Es verhindert jedoch, dass die Person merkt, dass es einen besseren Weg gibt. Ich werde daher im Anschluss aufzeigen, dass dieser tückische Mechanismus die Quelle vieler Voreingenommenheit im Umgang mit vertrauten Situationen ist – sowohl im täglichen Denken als auch bei Experten in ihrem Berufsleben.